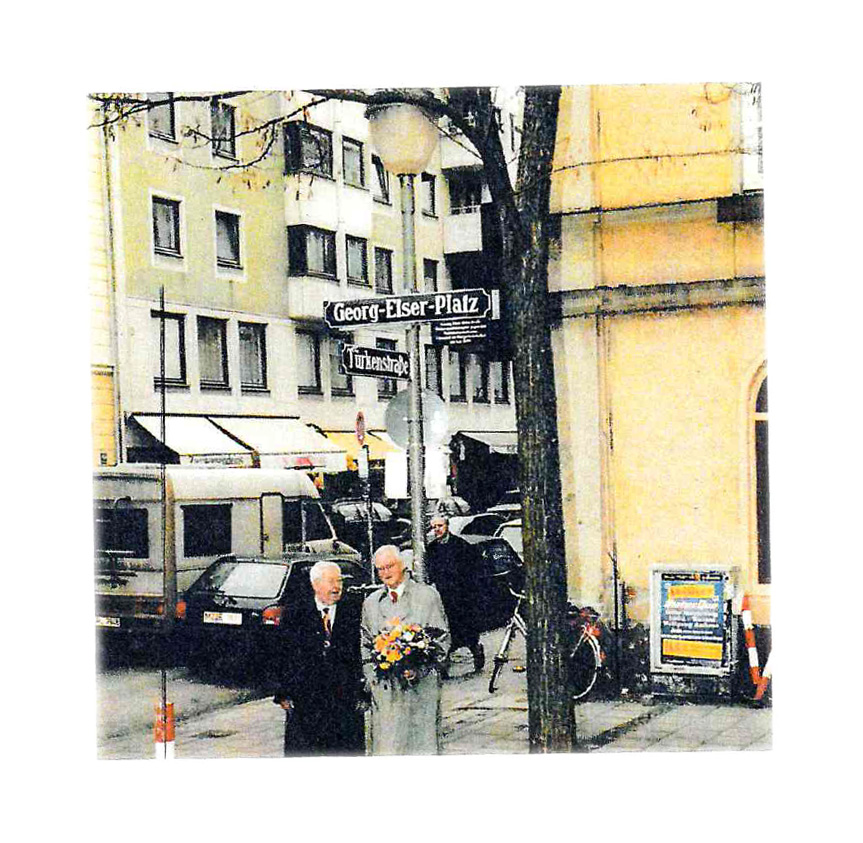Historiker für Geschichte in München: „Als Mensch furchtbar interessant.“
1. Lothar Gruchmann (1929-2015)
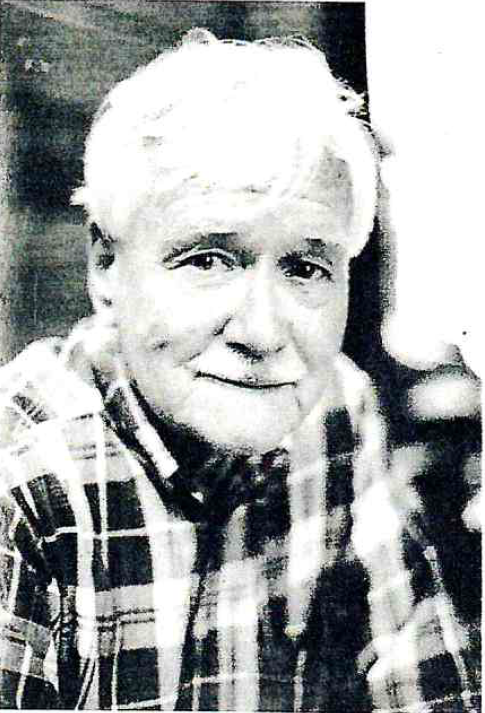
Als Mensch furchtbar interessant
Der Mann, der die Protokolle fand und veröffentlichte, gilt als der Elser-Forscher: der Historiker Dr. Lothar Gruchmann vom Institut für Zeitgeschichte in München. „Das Vernehmungsprotokoll Elsers habe ich eigentlich rein zufällig gefunden. Und zwar bei meinen Recherchen über die Justiz im Dritten Reich in den Akten des Reichsjustizministeriums, wo es eigentlich niemand vermutet hatte, da ja Elser nie der Prozess gemacht worden ist, sogar die Staatsanwaltschaft in München ausgesprochen angewiesen wurde, in diesem Fall nicht zu ermitteln. Die Auffindung geschah im Jahr 1964. Die Akten des Reichsjustizministeriums lagen damals noch im Archiv des Bundesjustizministeriums, also noch nicht im Bundesarchiv, und waren in verhältnismäßig ungeordnetem Zustand.
Und so war eigentlich ein Glückstreffer von mir, das Protokoll zu finden. Die Protokolle vom Wittelsbacher Palais sind ja nicht erhalten, aber man weiß, dass sie auch ein Geständnis Elsers darstellten.“ Auf die Frage, was ihn, den Wissenschaftler, mit dem Schreiner von der Schwäbischen Alb verbindet: „Mit Elser verbindet mich, wenn ich ehrlich sein soll, seine Identität, seine Verschwiegenheit, also, wie er die Sache anfasst. Ich finde ihn als Mensch furchtbar interessant. Dass er so verbohrt an einer Sache arbeitet, ganz verschwiegen, keine Helfer, das ist ein bisschen auch so die Art, wie ich bin. Elser sollte unbedingt die gleiche Ehrung erfahren wie die Männer des 20. Juli. Er war ja einer, der noch weit vor ihnen aktiv wurde. Die Offiziere sind ja erst zu einem Zeitpunkt aktiv geworden, als es mit Deutschland bergab ging. Elser wiederum hatte ja die Absicht, den Krieg überhaupt zu verhindern. Ich habe mich seither immer wieder gefragt, warum jene Führung, auf die wir Menschen keinen Einfluss haben, ausgerechnet mir dieses Dokument in die Hände gab.
Und ich habe in diesem Geschehen den verpflichtenden Auftrag gesehen, Georg Elser zu der verdienten Anerkennung als einem Mann des deutschen Widerstandes zu verhelfen. Denn in diesem Protokoll treten das Handeln und die Motive Elsers, die seine Charakterisierung als Widerstandskämpfer begründen, klar zutage. Nun mag der Laie sicher die Vorstellung haben, dass man mit einem Paukenschlag an die Öffentlichkeit getreten sei: „Sensation! Elserfrage Aber in der Realität entwickelte sich alles wenig spektakulär. Ich überließ das Protokoll kollegialer Weise zunächst einmal meinem Institutskollegen Dr. Anton Hoch zur Auswertung, der schon seit 1962 im Auftrag des Instituts an der Erforschung des Bürgerbräuattentats arbeitete. Mein einziges Interesse war eine wissenschaftliche, nicht eine journalistische Verwertung dieses Protokolls. Ich behielt mir aber die Veröffentlichung dieser wertvollen Quelle vor.
Es ist Hochs Verdienst, den Inhalt der Aussagen Elsers im Protokoll durch umfangreiche Recherchen und Befragungen überprüft und Elsers Alleintäterschaft wissenschaftlich nachgewiesen zu haben. Die Unterlagen sind heute noch im Archiv des Instituts einzusehen. Nachdem Hoch seine Forschungsergebnisse 1969 in den Vierteljahresheften veröffentlicht hatte, erschien 1970 meine Publikation des Protokolls mit dem Titel: „Autobiografie eines Attentäters“, mit einer umfassenden Einleitung und zeitgeschichtlich kommentiert. Ich musste damals noch die Genehmigung des Bundesjustizministeriums für die Veröffentlichung einholen. Justizminister war damals Gerhard Jahn und ich musste aus Gründen des Personenschutzes die im Protokoll erwähnten Namen abgekürzt wiedergeben.
Die zweite Auflage des Buches erschien 1989, zum 50. Jubiläum des Attentats zusammen mit dem Brandauerfilm. Der Verlag gab sozusagen das „Buch zum Film“ heraus und zu meinem Verdruss fand ich dann auf der Titelseite statt Elser den Brandauer abgebildet. Obwohl damit seit 1969/70 die Alleintäterschaft Elsers wissenschaftlich feststand, dauerte es noch Jahre, bis die Neuerscheinungen oder die Neuauflagen der bekannten zeitgeschichtlichen Literatur diese These übernahmen. Die Weiche war zwar neu gestellt, aber der Zug rollte trotzdem mit der Trägheit des Eigengewichts auf dem falschen Gleis weiter. Ein Beispiel: Alan Bullock, der in allen Ausgaben seiner bekannten Hitler-Biografie von einem „gestellten Attentat“ berichtete, übernahm erst in seiner vergleichenden Biografie von Hitler und Stalin, (deutsch 1991) die These von der Alleintäterschaft Elsers. Joachim bezeichnete in seiner Hitler-Biografie von 1973 das Attentat zwar als „offenbar das Werk eines Einzelgängers“, nannte jedoch den Namen Elsers nicht! Entsprechend lange brauchte auch die Anerkennung Elsers als Widerstandskämpfer in der Öffentlichkeit, obwohl seine politischen und moralischen Motive nunmehr klar ersichtlich waren.
Die einflussreichsten elitären Schichten, denen die Offiziere und Politiker des 20. Juli entstammten — gelegentlich als „Widerstandsaristokratie“ bezeichnet — hatten kein großes Interesse, den kleinen Mann aus kleinbürgerlich-proletarischen Verhältnissen an ihre Seite gestellt zu sehen; schon gar nicht, weil er in einer Zeit zur Tat geschritten war, in der weitere Verbrechen und Blutvergießen hätten verhindert werden können, während sich die Offiziere, die sich lange Zeit zumindest mit einigen Ziele Hitlers identifizieren, erst zum Attentat entschlossen, als sich die nationalsozialistischen Verbrechen auf ganz Europa ausgedehnt hatten und der Krieg für Deutschland verloren war. Verzögernd kam hinzu, dass kein Widerstandskreis den Einzelgänger fiir sich vereinnahmen konnte: weder die kommunistische oder gewerkschaftliche, noch die bürgerlich-liberale, • noch die kirchliche Opposition beider Konfessionen, auch kein jüdischer Verfolgtenverband.
Selbst in der DDR wurde Elser totgeschwiegen, da er nicht dem organisierten kommunistischen Widerstand zuzurechnen war. Folglich gab es keine medienwirksame Pressure Group und keine Lobby, die sich fir die öffentliche Anerkennung und Ehrung Elsers einsetzt*f. Verdienstvolle Ausnahmen waren die örtlichen Initiativen, die sich in Heidenheim, Königsbronn, München und Bremen bildeten. Einen wirklichen Durchbruch brachte erst die Erwähnung Elsers in der Gedenkrede von Bundeskanzler Kohl zum 50. Jahrestag des 20. Juli im Jahre 1994. Seitdem hat Elser erfreulicherweise zahlreiche Ehrungen erfahren.“